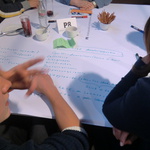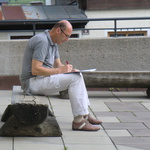RAUM.WERTschule
Zwangsläufig reagiert der Schulalltag auf gesellschaftliche Veränderungen. Die daraus resultierenden pädagogischen Konzepte wie Inklusion und Individualisierung des Unterrichts sind in breitem Konsens gewachsen. Auch das Erfordernis der Nachmittagsbetreuung gehört dazu. Baulich wird darauf oft mit dem Wunsch nach zusätzlichen Räumen reagiert. Die Annahme, dass einem Mehr an Funktionen zwingend ein Mehr an gebautem Raum folgen muss, führt jedoch in eine Sackgasse.
Schulen sind derzeit Gebäude, deren zeitlich getrennt genutzte Räume, abhängig von der Unterrichtsart, den Pausen und Funktionen, häufig leer stehen, was zu einer Verschwendung von baulichen – und damit finanziellen – Ressourcen führt, sowie zu verlängerten Wegen. Multifunktionalität in dem Sinn, dass jeder Raum „alles können“ muss, ist aber auch nicht die Lösung. Zuviel an Technik und Stauraum für spezielle Möbel und zu umständliche Umbauarbeiten sind die Folge. Besser als Multifunktionalität und totale Flexibilität ist es Nutzungsneutralität zu planen.
Partizipative Prozesse können das Verständnis für die räumlichen Bedürfnisse – eigene und die der Anderen – fördern. Ergebnis und Sinn ist Individualitäten und Gemeinsamkeiten zu erforschen, Unterschiedliches zu ermöglichen und Konsens zu finden. Dadurch entsteht Verantwortung und Identifikation aller mit „ihrem“ Gebäude und dessen Umraum. Dieses Mitwachsen in einem Planungsprozess bringt neben der Identifikation der Einzelnen mit dem komplexen Vorhaben die Erweiterung des individuellen Blickwinkels der Teilnehmenden, fördert die Toleranz gegenüber nötigen Adaptierungen und Veränderungen wie zb Mehrfachnutzungen und das Verständnis für die Notwendigkeit von Einsparungen.
Ergebnis des RAUM.WERTschule Prozesses ist ein räumlicher Qualitätenkatalog, der als Grundlage für die weitere Planung – egal ob Einzelbeauftragung oder Architekturwettbewerb – der Schulen dient.
RAUM.WERTschule ist im Rahmen des vom ÖISS herausgegebenen Leitfadens für Partizipationsprozesse mit Schulen (erstellt 02/2011) als eine Weiterentwicklung und Optimierung des darin beschriebenen partizipativen Prozesses und der Methoden zu sehen. Durch die Anwendung der 9 Parameter der RAUM.WERTanalyse werden die NutzerInnen selbst zu räumlichen ExpertInnen und damit zu vollwertigen Mitgliedern von Steuerungsgruppe und Plenum. Ein eigenes Team von räumlichen ExpertInnen ist daher nicht mehr zwingend erforderlich, die räumliche Kompetenz wird auch im ModeratorInnenteam abgedeckt. Eine Verflachung der Hierarchien und Kompetenzen ist die Folge.
– Genuine Contact von Birgitt Williams
– Großgruppenmethoden wie World Café und Open Space Conference
– Zürcher Ressourcenmodell von Maja Storch
– Effectuation von Michael Faschingbauer
– Theory U – Presencing von Claus Otto Scharmer
– Consensing aus der präventiven Mediation
– Gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg
- Montessori Innsbruck
- Montessori Innsbruck
- Montessori Innsbruck
- Montessori Innsbruck
- Montessori Innsbruck
- NMS Hall i. T.
- NMS Hall i. T.
- NMS Hall i. T.
- NMS Völs
- NMS Völs
- NMS Völs
- HS Egg
- HS Egg
- HS Egg
- HS Egg
- HS|SHS|PTS Neustift
- HS|SHS|PTS Neustift
- HS|SHS|PTS Neustift
- HS|SHS|PTS Neustift
- HS|SHS|PTS Neustift
- VS|HS Radstadt
- VS|HS Radstadt
- VS|HS Radstadt
- VS|HS Radstadt
- VS|HS Radstadt
- VS|SPZ Lustenau
- VS|SPZ Lustenau
- VS|SPZ Lustenau
- VS Landeck
- VS Landeck
- VS Landeck
- Pädag. Hochschule Salzburg
- Pädag. Hochschule Salzburg
- Pädag. Hochschule Salzburg
- pädag. hochschule salzburg